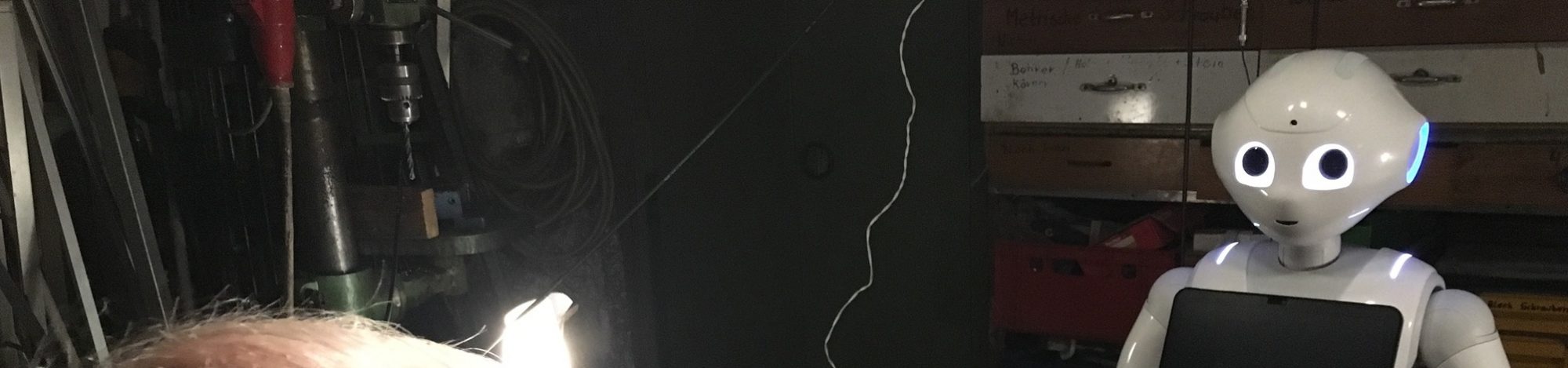Forscher der Universität Osaka in Japan haben jetzt den Grundstein dafür gelegt, dass Robotergesichtern eine Mimik zuteil werden kann, die von der des Menschen kaum noch zu unterscheiden ist. Das wäre vor allem für Service- und Pflegeroboter wichtig, bei denen es darauf ankommt, dass sie mit ihren Klienten ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Die Experten haben am Gesicht einer Person 125 Tracking-Marker platziert, um selbst die sparsamsten Bewegungen der Muskeln bei 44 verschiedenen Gesichtsausdrücken zu dokumentieren wie das Blinzeln oder das Anheben der Mundwinkel.
Einfache Bewegungen komplex
Jeder Gesichtsausdruck resultiert aus einer Vielzahl lokaler Verformungen, da die Muskeln die Haut dehnen oder straffen. Selbst die einfachsten Bewegungen können überraschend komplex sein. Dass menschliche Gesicht enthält eine Ansammlung verschiedener Gewebetypen unter der Haut, von Muskelfasern bis hin zu Fett, die alle zusammenarbeiten, um das aktuelle Befinden zu vermitteln. Dazu gehört alles von einem breiten Lächeln bis hin zu einem Anheben der Augenbrauen.
Diese Vielfalt macht die Mimik so subtil und nuanciert, was es wiederum schwierig gestaltet, sie künstlich zu reproduzieren, so die Forscher. Bisher beruhte dies auf viel einfacheren Messungen der gesamten Gesichtsform und der Bewegung ausgewählter Punkte auf der Haut vor und nach Bewegungen. „Unsere Gesichter sind uns so vertraut, dass wir die feinen Details nicht wahrnehmen. Aber aus technischer Sicht sind sie erstaunliche Informationsanzeigegeräte. Anhand der Gesichtsausdrücke von Menschen können wir erkennen, ob sich hinter einem Lächeln Traurigkeit verbirgt oder ob jemand müde oder nervös ist“, so Forscher Hisashi Ishihara.
Auch für medizinische Diagnostik
Die gesammelten Infos helfen den Forschern, künstliche Gesichter menschenähnlicher zu machen – ob es sich um Bildschirmdarstellungen handelt oder dreidimensionale Robotergesichter. „Unsere Deformationsanalyse erklärt, wie aus einfachen Gesichtsbewegungen anspruchsvolle Ausdrücke entstehen,“ so Mechanik-Professor Akihiro Nakatani. Sie könnte auch die Gesichtserkennung oder medizinische Diagnosen verbessern, indem Anomalien der Gesichtsbewegungen analysiert werden, die auf bestimmte Krankheiten hindeuten. Bisher ist dazu die Erfahrung eines Arztes nötig.
Quelle: www.pressetext.com
(pte002/10.11.2023/06:05)